Hans
Heigert
Das Missverständnis Eichmann
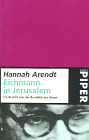 Wiedergelesen (2): Hannah Arendts Essays über die
„Banalität des Bösen“
Wiedergelesen (2): Hannah Arendts Essays über die
„Banalität des Bösen“
Adolf Eichmann war kein Monster, keine Bestie in
Menschengestalt, kein Menschenschinder, der
eigenhändig Menschen ausgepeitscht oder sie
persönlich erschossen hätte. Ganz im Gegenteil:
Der Mann war ganz gewöhnlich, banal, nicht eigentlich
böse. Er war ein Bürokrat in SS-Uniform. Er
transportierte Hunderttausende von europäischen Juden
in die Vernichtungslager in Polen. Er kannte diese aus
kurzen Besuchen, zeigte dabei „Schwäche“,
wollte niemals mehr dorthin. Aber am Schreibtisch
erfüllte er seine „Pflicht“, auch
gelegentlich am Verladebahnhof, und auch bei den
Verhandlungen mit den „Judenräten“, den so
genannten Selbstverwaltungsorganen.
Man muss sich das vorstellen: Die Bürokratie des
Adolf Eichmann war so penibel, dass er noch die letzte
Person der Todgeweihten registrierte. Aus Ungarn, wo
allerdings die dortige Gendarmerie auf eine entsetzlich
bemühte Weise mithalf, wurden in zwei Monaten 147
Züge mit 434 351
Menschen abtransportiert. In Auschwitz konnten sie
diese Menge kaum „aufnehmen“.
Hannah Arendt, Philosophin, politische Wissenschaftlerin
und Soziologin der Heidelberg Schule, war von der
Zeitschrift
The New Yorker
zur Prozessberichterstattung nach Jerusalem geschickt
worden. Das geschah wohl deshalb, weil sie bereits bekannt
und berühmt war wegen ihres gründlich
erarbeiteten Buchs „Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft“. Zunächst entstanden
fünf Essays, dann ein Buch: „Eichmann in
Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des
Bösen.“ In der Serie Piper ist noch eine Studie
des renommierten Historikers Hans Mommsen vorausgeschickt. Auflage in deutsch: 60 000.
Kaum in englischer Sprache erschienen, zum Teil vorher,
lösten die Gedanken und Kritiken der Autorin einen
Sturm der Entrüstung aus. Das hatte verschiedene
Gründe. In wesentlichen Einwänden wies sie auf
die in der Tat schwer wiegenden Widersprüche der
Gerichtsverhandlung hin, besonders zwischen dem Auftreten
des Generalstaatsanwalts Hausner einerseits und dem
Erscheinungsbild des Angeklagten – auch zum hinter
allem liegenden Zweck der Urteilsfindung. Nicht an der
völkerrechtswidrigen, geheimen und gewaltsamen
Entführung durch ein israelisches Sonderkommando aus
Argentinien heraus nahm sie Anstoß (die
Empörung darüber war auch im Rest der Welt
begrenzt und nur kurz). Sondern an der dahinter liegenden
Motivation.
Unzufriedenheit herrschte in Israel, dem noch sehr jungen
Staat, mit den Verlauf des ersten großen
Nürnberger Prozesses, der sich ja vor allem mit der
Vorbereitung und Ausführung von
Kriegsverbrechen
befasste, kaum aber mit der „Endlösung“ der
Judenverfolgung. Man wollte in Israel einen ganz
großen Prozess führen. Ministerpräsident
Ben Gurion selbst hatte das Kidnapping angeordnet. Der
Prozess sollte in Jerusalem stattfinden, vor einem allein
jüdischen, nicht international besetzten Gericht.
Hannah Arendt kritisierte die dahinter weit verbreitete
Attitüde, sich bloß nicht in die Serie der
internationalen Verfahren einzureihen. Man wollte
demonstrativ der Welt zeigen, was den Juden, und nur ihnen
angetan wurde: ihre massenhafte Vernichtung. Und in
Eichmann glaubte man einen führenden Hauptschuldigen
gefunden zu haben. Aber (Arendt): „Eichmann war nicht
Jago und nicht Macbeth, und nichts hätte ihm ferner
gelegen, als mit Richard III.
zu beschließen, ein Bösewicht zu werden:
Außer einer ganz ungewöhnlichen Beflissenheit,
alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich sein konnte,
hatte er überhaupt keine Motive . . .
Er hat sich nur niemals vorgestellt, was er eigentlich
anstellte.“ Das kennt man ja auch bei anderen,
gewöhnlichen Straftätern. Und in der Tat, wie er
selbst einmal sagte, andere hätten ebenso gehandelt.
Das eben ist es. Er war gleichsam beispielhaft.
Adolf Eichmann war im Sinne des Rechts einer der
Hauptschuldigen an den Verbrechen gegen die Menschheit,
aber er war ein ganz durchschnittlicher Patron. Das allein
wollte vielen nicht in den Kopf. Am meisten verstand man
davon in Deutschland. Hier war man mit solchen Typen
vertraut. Vielleicht erklärt dies die Tatsache, dass
das Echo auf den Prozess bei den Deutschen vergleichsweise
gering war. Die einen wollten nichts mehr davon wissen,
die anderen kannten sich in der ganzen Erbärmlichkeit
gut aus. Sie sahen (oder ahnten doch) die Wahrheit, hatten
ins Antlitz des trivialen Durchschnitts geblickt.
Was aber den Protest gegen Hannah Arendts Gedanken zum
Prozess so leidenschaftlich machte – zumal in Israel
–, das war die Erörterung der Tatsache, dass die
ganze Transport- und Vernichtungsmaschinerie nicht so
perfekt funktioniert hätte ohne die Mitwirkung der
„Judenräte“ (oder wie immer die
„Selbstverwaltungsorgane“ der Juden
hießen). Es war dies eine besondere Perfidie der
SS-Oberen, die Juden selbst zum Registrieren, Einsammeln,
Aussondern, Transportieren ihrer Mitmenschen zu bewegen.
Dies ist in der Tat ein besonders düsteres Kapitel
des ganzen Holocausts. Tatsächlich meinten ja nicht
wenige prominente Juden, auch Zionisten (bis 1936),
man könne mit den nationalsozialistischen
Machthabern zu irgendeinem Modus vivendi kommen – für die Auswandernden, für die
Hierbleibenden. Auch Hitler und seine SS hatten ja noch
kein „Konzept“. Die
„Wannsee-Konferenz“ zur Endlösung fand erst
1942 statt. Die Motive reichten von der irrwitzigen
Hoffnung auf ein geregeltes Verhältnis – es hat
ja selbst höhere SS-Führer gegeben, die das in
freundlichen Gesprächen nährten (selbst Eichmann
rühmte sich solchen höflichen Gedankenaustauschs
mit Juden) – bis zur verzweifelten Hoffnung, man
könne das Schlimmste verhindern, oder gleichsam Tag
für Tag einige Wenige retten, noch beim Verladen,
selbst noch auf der Rampe. Manche hofften bloß noch
auf einen Aufschub, vom einen auf den anderen Moment.
Hannah Arendt, die nichts dergleichen persönlich
hatte durchleiden müssen, weil sie schon 1933
emigrierte, musste sich den Vorwurf der Ahnungslosigkeit
gefallen lassen. Viele Prominente wandten sich gerade
deshalb gegen sie, zum Beispiel Martin Buber oder
Manès Sperber, Probst Grüber, Golo Mann und
andere, besonders Israelis.
Am meisten berührte der bewegte Einwand des hoch
angesehenen, schon älteren Religionswissenschaftlers
Gershom Scholem: „Es hat die Judenräte gegeben.
Einige waren Lumpen, andere Heilige . . .
(Aber) es gibt in der jüdischen Sprache einen
Ausdruck, der die ,Liebe zu den Juden‘ anmahnt. Davon
ist bei Ihnen, liebe Hannah, nichts zu merken.“ Ein
bitterer Vorwurf. Arendt antwortet in der ihr eigenen
kühlen Art. „Sie haben vollkommen recht, dass
ich eine solche Liebe nicht habe, und dies aus zwei
Gründen. Erstens habe ich nie in meinem Leben
irgendein Volk oder Kollektiv ,geliebt‘, weder das
deutsche noch das französische oder amerikanische . . .
Ich liebe nur meine Freunde. Zweitens aber wäre mir
diese Liebe zu den Juden, da ich ja selbst Jüdin bin,
suspekt.“ Hier enthüllt sich die ganze
Überzeugung der Autorin. Sie hat auch energisch die
„verhängnisvolle Nicht-Trennung von Religion und
Staat in Israel“ kritisiert, wenn nicht angeprangert
– gerade vor dem Hintergrund dessen, was in Europa
(zumal in Deutschland) geschehen war. Derlei musste den
Zorn vieler Juden hervorrufen, nicht nur der Orthodoxen.
Bis heute ist das ein zentrales Problem Israels.
Am Ende ihres Briefwechsels mit Scholem schreibt die
Autorin: „Das Böse ist immer nur extrem, aber
niemals radikal. Es kann die ganze Welt verwüsten,
weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert.
Tief aber und radikal ist immer nur das Gute.“